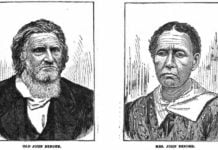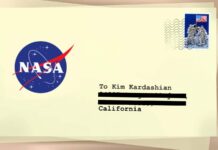Der Klimawandel führt nicht nur zu heißeren Sommern und einem Anstieg des Meeresspiegels; Es führt auch zu häufigeren Zusammenstößen zwischen Menschen und Wildtieren, insbesondere während Dürreperioden. Dieser beunruhigende Trend geht aus einer neuen Studie von Forschern der UCLA und UC Davis hervor, die jahrelange Daten zu Begegnungen mit Wildtieren in ganz Kalifornien analysierten. Ihre in Science Advances veröffentlichten Ergebnisse legen nahe, dass die zunehmende Häufigkeit von Dürren den Wettbewerb um schwindende Ressourcen verschärft und Tiere in engere Nähe zu Menschen drängt.
Für jeden Zoll weniger Niederschlag pro Jahr beobachteten die Forscher einen Anstieg der gemeldeten Konflikte mit verschiedenen Fleischfressern in Dürrejahren um 2 bis 3 %. Zu diesen Tieren gehörten Berglöwen, Kojoten, Schwarzbären und Rotluchse – alles Arten, von denen bekannt ist, dass sie ihr Verhalten an die Verfügbarkeit von Ressourcen anpassen. Der Hauptautor Kendall Calhoun, ein Postdoktorand und Naturschutzökologe beider Universitäten, betonte die umfassenderen Auswirkungen dieser Ergebnisse und erklärte: „Der Klimawandel wird die Interaktionen zwischen Mensch und Tier verstärken, und da Dürren und Waldbrände immer extremer werden, müssen wir Wege für das Zusammenleben mit der Tierwelt planen.“
Definition von „Konflikt“ in einer sich verändernden Landschaft
Die Studie stützte sich auf die kalifornische Wildlife Incident Reporting-Datenbank, die vom Department of Fish and Wildlife verwaltet wird. Diese Daten erfassten Fälle, die als „Belästigung“ oder Sachbeschädigung eingestuft wurden, und nicht als direkte Angriffe auf Menschen. Die Forscher erkannten an, dass die Definition von „Konflikt“ subjektiv ist, da das, was eine Person als Belästigung empfindet (z. B. Vögel, die Feldfrüchte fressen), eine andere als nützliche Schädlingsbekämpfung ansehen könnte.
Calhoun erklärt: „Es ist unklar, ob die Zahl der Meldungen steigt, weil es subjektiv mehr Konflikte gibt oder weil Menschen die Tierwelt negativer wahrnehmen, wenn ihre eigenen Ressourcen stärker beansprucht werden.“
Beyond Numbers: Ein Aufruf für klimaresistente Lebensräume
Während es schwierig ist, definitiv zu sagen, ob Dürrebedingungen tatsächlich mehr Kojoten in städtische Gebiete drängen, deuten die Daten eindeutig darauf hin, dass der Mensch diese Begegnungen während Trockenperioden stärker wahrnimmt. Calhoun weist darauf hin, dass dies einen entscheidenden Punkt unterstreicht: Der Klimawandel verändert nicht nur die Wettermuster; Es verändert Ökosysteme grundlegend. Tiere, die aufgrund knapper werdender Ressourcen aus ihren angestammten Lebensräumen vertrieben werden, sind gezwungen, woanders Zuflucht zu suchen – oft in Überschneidungen mit menschlichem Territorium.
„Da wir nun wissen, wie Dürren die Interaktion zwischen Wildtieren verschlechtern, warum könnten wir sie dann nicht verbessern?“ fragt Calhoun. Er betont das Potenzial der Schaffung „klimaresistenter Landschaften für Wildtiere“ – Schutzgebiete voller ausreichender Nahrungs- und Wasserquellen. Solche Zufluchtsorte könnten Tiere vom Eindringen in menschliche Siedlungen abhalten und Konflikte abmildern, bevor sie eskalieren.
Calhouns Forschung, die auf der Analyse von Brandmustern und ihren Auswirkungen auf Tierlebensräume basiert, verdeutlicht die Vernetzung dieser Probleme. Dürren erzeugen einen Dominoeffekt: Die verringerte Wasserverfügbarkeit zwingt Wildtiere in trockenere, gefährdetere Gebiete. Dann führen Waldbrände, die durch anhaltende Dürreperioden angeheizt werden, zu einer weiteren Verkleinerung des verfügbaren Lebensraums, wodurch die Tiere noch näher an vom Menschen dominierte Zonen gedrängt werden.
Diese kalifornische Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit proaktiver Lösungen. Wenn wir verstehen, wie der Klimawandel das Gleichgewicht zwischen Menschen und Wildtieren verändert, können wir mit der Planung von Strategien beginnen, die das Zusammenleben in einer Welt fördern, die zunehmend von Umweltinstabilität geprägt ist.